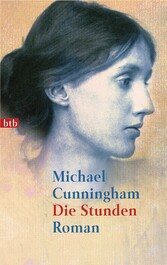
Die Stunden - Roman
von: Michael Cunningham
btb, 2014
ISBN: 9783641146900
Sprache: Deutsch
224 Seiten, Download: 1523 KB
Format: EPUB, auch als Online-Lesen
Mrs. Dalloway
Die Blumen müssen noch besorgt werden. Clarissa gibt sich gereizt (obgleich sie solche Aufgaben liebt), lässt Sally das Badezimmer putzen, verspricht, in einer halben Stunde zurück zu sein, und stürmt hinaus.
New York City. Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts.
Der Junimorgen draußen vor der Tür zum Vestibül ist so schön und klar, dass Clarissa auf der Schwelle innehält wie am Rand eines Schwimmbeckens, als betrachtete sie das türkise Wasser, das an die Kacheln schwappt, das flimmernde Gespinst der Sonnenstrahlen in der blauen Tiefe. Als stünde sie am Rand eines Schwimmbeckens, zögert sie den Sprung hinaus, den jähen Eishauch, den schieren Schock beim Eintauchen. New York mit seinem Lärm und seiner düsteren braunen Hinfälligkeit, seinem bodenlosen Niedergang, bringt immer ein paar Sommermorgen wie diesen zustande; Morgen, die durchdrungen sind von neuem Leben, das sich überall mit einer solchen Entschiedenheit behauptet, dass es fast komisch ist, wie eine Comicfigur, die andauernd schreckliche Prügel einstecken muss und immer wieder unversehrt, ungeschoren davonkommt, bereit zu mehr. Auch in diesem Juni haben die Bäume entlang der West Tenth Street auf dem spärlichen Stück Boden voller Hundedreck und weggeworfener Verpackungen, auf dem sie stehen, wieder makellose kleine Blätter ausgetrieben. Wieder ist in dem Blumenkasten der alten Frau nebenan, in dem wie immer verblichene rote Plastikgeranien in der Erde stecken, ein einzelner Löwenzahn aufgegangen.
Was für ein Kribbeln, was für ein Schock, an einem Junimorgen am Leben zu sein, wohlhabend, geradezu unanständig vom Glück begünstigt, und einen simplen Einkauf tätigen zu müssen. Sie, Clarissa Vaughan, ein ganz gewöhnlicher Mensch (wieso sollte sie das in ihrem Alter noch leugnen?), muss Blumen besorgen und eine Party geben. Als Clarissa aus dem Vestibül tritt, berührt ihr Fuß den rotbraunen, mit Glimmer durchsetzten Stein der ersten Treppenstufe. Sie ist zweiundfünfzig, gerade mal zweiundfünfzig, und beinahe unnatürlich gesund. Sie fühlt sich noch genauso gut wie damals in Wellfleet, mit achtzehn Jahren, als sie durch die Glastür in einen Tag hinaustrat, der ganz ähnlich war wie dieser, frisch und beinahe schmerzhaft klar, üppig und grün. Libellen schwirrten zwischen den Rohrkolben dahin. Es roch nach Gras und herbem Kiefernharz. Richard kam hinter ihr heraus, legte ihr die Hand auf die Schulter und sagte: »Oh, hallo, Mrs. Dalloway.« Der Name war Richards Idee gewesen – eine spontane Eingebung, einer trunkenen Nacht im Wohnheim entsprungen, in der er sie überzeugte, dass Vaughan nicht der passende Name für sie sei. Sie müsse, hatte er gesagt, nach einer großen literarischen Gestalt benannt werden, und während sie Isabel Archer oder Anna Karenina hatte durchsetzen wollen, hatte Richard darauf beharrt, dass die Wahl aus naheliegenden Gründen nur auf Mrs. Dalloway fallen könne. Da sei zum einen ihr Vorname, ein allzu offenkundiges Zeichen, als dass man es missachten dürfe, und außerdem, was noch wichtiger sei, stelle sich auch die Schicksalsfrage. Sie, Clarissa, sei eindeutig nicht der Typ, der eine unglückliche Ehe einging oder unter einen Zug geriet. Ihr seien Liebreiz und Wohlergehen beschieden. Mrs. Dalloway also, und dabei würde es auch bleiben. »Ist es nicht wunderschön heute?«, sagte Mrs. Dalloway an diesem Morgen zu Richard. »Die Schönheit ist eine Hure«, antwortete er. »Geld ist mir lieber.« Er zog Esprit vor. Clarissa, die die Jüngste war, die einzige Frau, meinte sich eine gewisse Gefühlsduselei herausnehmen zu können. Wenn es schon Ende Juni gewesen wäre, dann wären sie und Richard ein Paar. Dann wäre es fast einen ganzen Monat her, seit Richard Louis’ Lager verlassen hatte (Louis mit dem Silberblick, der Inbegriff des Bauernjungen, die verkörperte Fleischeslust) und in ihres übergesiedelt war.
»Tja, zufällig stehe ich auf Schönheit«, hatte sie gesagt. Sie hatte seine Hand von ihrer Schulter genommen und ihn in die Zeigefingerspitze gebissen, ein bisschen fester als beabsichtigt. Sie war achtzehn, hatte einen neuen Namen. Sie konnte tun, was ihr gefiel.
Clarissas Schuhe scharren wie feines Sandpapier über die Stufen, als sie die Treppe hinabsteigt, um Blumen zu besorgen. Wieso ist sie nicht schwermütiger angesichts dieser verqueren Verkettung von Glück (»eine beklommene, prophetische Stimme in der amerikanischen Literatur«) und Richards gleichzeitigem Verfall (»Sie haben überhaupt keine T-Zellen mehr, keine, die wir feststellen können«)? Was stimmt mit ihr nicht? Sie liebt Richard, sie denkt ständig an ihn, aber den Tag liebt sie vielleicht noch ein bisschen mehr. Sie liebt die West Tenth Street an einem gewöhnlichen Sommermorgen. Sie kommt sich vor wie eine liederliche Witwe mit frisch blondiertem Haar unter ihrem schwarzen Schleier, die beim Leichenschmaus für ihren Gatten ein Auge auf die verfügbaren Männer hat. Von allen dreien – Louis, Richard und Clarissa – ist Clarissa immer die Hartherzigste gewesen und diejenige, die am romantischsten veranlagt ist. Über dreißig Jahre lang hat sie deswegen Sticheleien einstecken müssen; vor langem schon hat sie beschlossen, sich zu fügen und ihre sinnlichen, undisziplinierten Reaktionen auszukosten, die, wie Richard es ausdrückte, für gewöhnlich genauso ungezogen und schwärmerisch sind wie die eines besonders aufsässigen, frühreifen Kindes. Sie weiß, dass ein Dichter wie Richard denselben Morgen mit strengem Blick betrachten, ihn bearbeiten, die gelegentliche Hässlichkeit ebenso verwerfen würde wie die beiläufige Schönheit, dass er die ökonomische und historische Wahrheit hinter diesen alten Ziegelhäusern, dem nüchternen, kunstvollen Mauerwerk der Episkopalkirche, dem dünnen Mann mittleren Alters suchen würde, der seinen Jack-Russell-Terrier ausführt (an der Fifth Avenue sind sie mit einem Mal allgegenwärtig, diese wusligen, o-beinigen kleinen Hunde), während sie, Clarissa, sich einfach grundlos an den Häusern ergötzt, der Kirche, dem Mann und dem Hund. Es ist kindisch, das weiß sie. Es fehlt der Biss. Wenn sie diese ihre Liebe öffentlich kundtäte (heute, in ihrem Alter), würde man sie als dumm und einfältig abstempeln wie die Christen mit ihren Wanderklampfen oder die Frauen, die sich in die Rolle des unbedarften Hausweibchens fügen, wenn sie ihrerseits ausgehalten werden. Und dennoch hat sie das Gefühl, dass sie diese allumfassende Liebe ernst nehmen muss, als sei alles auf dieser Welt Teil eines großen, unerforschlichen Ganzen, als trage alles seinen eigenen geheimen Namen, einen Namen, der sich nicht durch Sprache vermitteln lässt, sondern einfach im Sehen und Fühlen der Sache an sich besteht. Diese entschiedene, nachhaltige Faszination ist das, was sie als Ausdruck ihrer Seele empfindet (ein peinliches, rührseliges Wort, aber wie soll man es sonst nennen?); den Teil von ihr, der womöglich den Tod der leiblichen Hülle überdauert. Darüber spricht Clarissa mit niemandem. Sie quatscht und plappert nicht. Sie äußert sich nur, wenn etwas offenkundig schön ist, und selbst dann kann sie eine gewisse abgeklärte Zurückhaltung wahren. Die Schönheit ist eine Hure, sagt sie manchmal. Geld ist mir lieber.
Heute Abend wird sie eine Party geben. Überall in ihrer Wohnung werden Blumen sein, Büfetts, Menschen mit Esprit und Einfluss. Sie wird Richard hindurchführen, achtgeben, dass er nicht zu sehr ermüdet, und danach wird sie ihn uptown zur Preisverleihung begleiten.
Sie strafft die Schultern, als sie an der Fifth Avenue, Ecke Eighth Street steht, an der Ampel wartet. Da ist sie, denkt Willie Bass, der ihr morgens manchmal an ebendieser Stelle begegnet. Die alte Schönheit, das alte Hippiemädchen, nach wie vor mit langem Haar, das selbst ergraut noch trotzig wirkt, auf ihrer morgendlichen Runde, in Jeans und einem derben Männerhemd, mit irgendwelchen Ethnoslippern (aus Indien? Mittelamerika?) an den Füßen. Sie besitzt immer noch eine gewisse Sinnlichkeit; einen gewissen bohemienhaften, hexenartigen Charme; und doch wirkt sie an diesem Morgen eher tragisch, wie sie so aufrecht dasteht in ihrem weiten Hemd und den Drittweltschuhen, sich gegen die Schwerkraft wehrt, wie ein Mammutweibchen, das bereits bis zu den Knien in einem Teersee steckt, eine kurze Ruhepause einlegt, stolz und wuchtig aufragt, lässig beinahe, so tut, als betrachte es die zarten Gräser, die es am andern Ufer erwarten, während es allmählich begreift, dass es hier festsitzt, allein, nach Einbruch der Dunkelheit, wenn die Schakale ausschwärmen. Geduldig wartet sie an der Ampel. Vor fünfundzwanzig Jahren musste sie umwerfend gewesen sein; die Männer müssen in ihren Armen dahingeflossen sein. Willie Bass ist stolz darauf, dass er die Geschichte eines Gesichts deuten kann; begreifen, dass diejenigen, die heute alt sind, einst jung waren. Die Ampel springt um, und er geht weiter.
Clarissa überquert die Eighth Street. Sie ist hoffnungslos in den ausgedienten Fernseher verliebt, der verlassen neben einem einzelnen Stöckelschuh aus weißem Kunstleder am Straßenrand steht. Sie liebt den Karren des Obsthändlers, auf dem sich Brokkoli, Pfirsiche und Mangos türmen, alle mit einem Schild versehen, auf dem der Preis und eine Fülle von Satzzeichen prangen: »$ 1.49!!«, »3 für EINEN Dollar!?!« »50 Cents pro St.!!!!!« Vor ihr, unter dem Bogen, steht eine alte Frau in einem dunklen, hübsch geschnittenen Kleid, die anscheinend singt, genau zwischen den zwei Statuen von George Washington, dem Heerführer und dem Staatsmann, beide mit verwittertem Gesicht. Das ständige Wogen und Branden dieser Stadt ist es, was einen bewegt, ihre Vielschichtigkeit, ihre unendliche Lebenskraft. Man kennt die Geschichte von Manhattan, weiß, dass es einst eine Wildnis war, die für ein paar...










